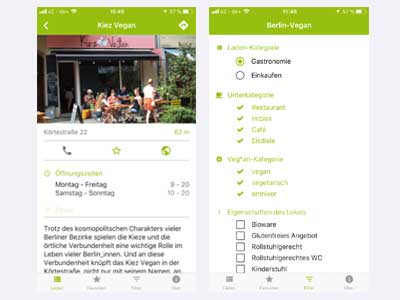Martin Balluch – Der Hund und sein Philosoph. Plädoyer für Autonomie und Tierrechte
Wien, Promedia Verlag 2014, ISBN 978-3853713778
1. Tiere sind wie wir – oder nicht?
Oft denke ich mir, eine Welt, in der gut sozialisierte Hunde herumlaufen können und sich in Eigenregie mit den Menschen und anderen Hunden arrangieren, wäre viel farbiger, viel schöner.
Martin Balluch
Hunde sind auch nur Menschen, könnte man Martin Balluchs neues Buch salopp zusammenfassen. Die Grenze zwischen Mensch und Tier, so der Autor, ist willkürlich; wir teilen mit Schimpansen und Bonobos weit mehr Gene als Pferde und Esel, Löwen und Tiger miteinander gemein haben, und doch sehen wir uns selbst als getrennt vom Tierreich aller, die nicht menschlich sind, seien es Schimpansen oder Mikroben. Logisch ist das nicht.
Martin Balluch weiß viel über nichtmenschliche Tiere und viel über Tierausbeutung. Als jemand, der seit Dekaden mit PolitikerInnen verhandelt, sich auf ihre Sprache und ihr Denken einlässt, um oft auch minimale Verbesserungen der Lage der Tiere zu bewirken, und mit der Erfahrung des Gefangenen, für den auch das kleinste bisschen mehr Selbstbestimmung ein Zugewinn an Freiheit ist, kennt er die Politik der kleinen Schritte und der ermüdenden Verhandlungen gut – zu gut, wie manche meinen – und stellt in seinem neusten Buch als Kontrast eine utopische Vision vor, in der alle Lebewesen gleiche Rechte haben, ihre natürlichen Bedürfnisse soweit wie möglich auszuleben, am Beispiel seines Zusammenlebens mit seinem Hundefreund Kuksi, mit dem er dieses egalitäre Zusammenleben weitestmöglich modellhaft versucht, als Prototypen einer Multispezies- und nicht mehr speziesistischen Gesellschaft der Zukunft.
In seinem Buch bringt er Forschungsergebnisse der Verhaltensforschung und Primatologie und seine eigenen Beobachtungen und Erfahrungen aus seiner Freundschaft mit Kuksi und dem Schimpansen Hiasl, über das Gefühls- und Ausdrucksrepertoire nichtmenschlicher Tiere ebenso wie über ihre Kulturen und Bedürfnisse, in einen erkenntnistheoretischen Zusammenhang. Die rechtliche Stellung nichtmenschlicher Tiere als bloßer Sachen erscheint ihm vor diesem Hintergrund als faktisch unhaltbar, die Vorstellung, dass nichtmenschliche Tiere wie sein Hund Kuksi nur deshalb ein Recht auf Leben und Unversehrtheit haben soll, weil sonst seine, Martin Balluchs, Eigentumsrechte geschädigt werden, empört ihn vor diesem Hintergrund unsäglich.
2. Kuksi hat Krebs: Was ist ein Freund wert?
Ohne an dieser Stelle die utilitaristischen Hintergründe dieser Diskussion zu erwähnen, die auf Jeremy Bentham und Peter Singer beruhen und bereits von Tom Regan und zuletzt von Gary Steiner diskutiert wurden und teils entschiedenen Widerspruch erfuhren, beschreibt er, warum es für ihn keine Alternative dazu gab, tausende von Euro in die Krebsbehandlung seines Kuksi zu stecken, auch wenn er mit diesem Geld vielen anderen Hunden das Leben hätte retten können – aber eben nicht Kuksis.
Für ihn war das ebenso wenig fraglich, wie wir uns dafür entscheiden würden, unser eigenes Kind sterben zu lassen, nur weil wir stattdessen mehrere andere Kinder retten könnten. Die utilitaristische Lösung, der zufolge man versuchen müsste, mit so wenig Geld so viele Leben wie möglich zu retten, wird obsolet, sobald es für uns nicht mehr um irgendeinen Hund, um irgendein Kind geht, sondern um mein Kind, meinen Hund, das oder der mir das nächste ist. Dabei geht es nicht um absolute Werte, sondern einfach um die unterschiedliche Nähe zu unterschiedlichen Individuen. Mit der Aussage, dass ich eher mein Kind rette als irgendein anderes, ist kein Werturteil verbunden, sondern nur die Tatsache, dass mir mein Kind näher steht als irgendein anderes. Warum sollte dieses Argument für nichtmenschliche Tiere nicht ebenso gelten, sobald wir sie als die Individuen wahrnehmen, die sie sind, und nicht mehr nur als Biomasse?
Dass die Grenze zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Tieren eine willkürliche ist, dass die Grenzen zwischen den Arten nur quantitativ, nicht aber qualitativ sind, wissen wir spätestens seit Charles Darwin, auch wenn gerade die Naturwissenschaften, die diesen fehlenden Unterschied festgestellt haben, nichtmenschliche Tiere kategorischer denn je als lebende Automaten, als Sachen und nicht als fühlende Individuen behandeln, wenn man sich die Wissenschaftsprosa der Biologie, der Agrarwissenschaften oder anderer Disziplinen, in denen Tiere objektifiziert werden, vor Augen hält. Martin Balluch verbindet nun diese Erkenntnisse der nahen Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier mit den konkreten Individuen Kuksi und Hiasl, die er als seine Freunde begreift und vorstellt, und führt damit ad absurdum, wie die Mehrheitsgesellschaft mit der Mehrheit der nichtmenschlichen Tiere umgeht, die als Haustiere, als Nutztiere oder als Wildtiere vor dem Gesetz und in den Augen der meisten Menschen nach wie vor bloße Biomasse sind, denen wir keine Gefühle zugestehen, und deren bloßes Existenzrecht sich allein daraus ableitet, ob sie für uns nützlich oder wenigstens erfreulich sind, und über deren Leben und Tod wir allein nach Nützlichkeitskriterien entscheiden.
Dass diese Kriterien gewöhnlich durch den Profit – und nicht etwa durch die Bedürfnisse – einiger weniger Menschen definiert werden, machte kürzlich ein deutsches Gericht eindrücklich deutlich, in dem es klar urteilte, dass die wirtschaftlichen Interessen der großen Brütereien über dem Lebensrecht der männlichen Eintagsküken stehen, und dass das Verbot der Kükentötung in Deutschland darum um des Profits einiger weniger Unternehmer willen nicht durchsetzbar sei. Dieses zahl- und namenlose Tierleid zeigt vor dem Hintergrund dessen, was wir längst über das Leben und Leiden der Tiere wissen, eine unbegreifliche kognitive Dissonanz: Wie könnten wir derartiges Tierleid ruhigen Gewissens dulden, wenn wir doch wissen, dass und wie Tiere fühlen?
Martin entkräftet das häufige Argument von Zoofreunden und Bauern, „ihren“ Tieren gehe es gut, denn sie hätten doch alles, was sie brauchten. Viele Befürworter der Nutztierhaltung zitieren an dieser Stelle die Vorstellung von einem Vertrag, den Mensch und Tier miteinander schlössen: „ich gebe dir Nahrung, Schutz vor deinen Feinden und eine Unterkunft gegen Wind und Wetter, und du gibst mir dafür deine Milch, deine Eier und dein Fleisch“ (zuletzt hörte ich das von einem Biobauern im bayrischen Rundfunk). Ich habe allerdings nicht nur nie von einem solchen von beiden Seiten unterschriebenen Vertrag gehört, sondern bin auch der festen Überzeugung, dass jedes nichtmenschliche Tier spätestens an der Stelle mit dem Fleisch den Kugelschreiber hingeworfen hätte und schreiend davon gelaufen wäre.
Martin beschreibt dieses grundlegende Bedürfnis nach Freiheit sehr eindrücklich, gerade auch in Erinnerung an seine eigene Erfahrungen aus der Zeit des Gefängnisaufenthalts. Er macht deutlich, wie wesentlich die Bewegungsfreiheit für Mensch und Tier ist, die sich sogar entscheiden können, sich notfalls freiwillig Kälte, Hunger oder Schmerzen auszusetzen, als Preis der persönlichen Freiheit, und er vergleicht dies mit seinen Beobachtungen aus dem Leben und Sterben der „Nutztiere“, denen von der Geburt bis zum Tod jede, auch noch die geringste Freiheit genommen wird.
3. Wer zählt und wer nicht? Ein gesellschaftlicher Konsens
Der Appell Jeremy Benthams, der schon vor über zwei Jahrhunderten die Leidensfähigkeit von Tieren als Kriterium für ihre Behandlung propagierte, zählt da ebenso wenig wie die Erkenntnisse der modernen Biologie, die diese Empfindungs- und Leidensfähigkeit der Tiere längst mit zahllosen Beispielen belegte. All diese Tatsachen zählen nichts vor den Bedürfnissen der Wirtschaft, und so gesellt sich Martin Balluchs Plädoyer für Tierrechte zu all den ungehörten Appellen der Tierrechtler von der Antike bis in die Gegenwart. Je lauter ihre Stimmen wurden, desto mächtiger die Durchsetzungskraft der wirtschaftlichen Interessen. Vermutlich braucht es für einen grundlegenden Bewusstseinswandel mehr als bloße Appelle und rationale Erwägungen, die nicht stärker sind als grenzenlose Egoismus und funktionierenden Verdrängungsmechanismen der meisten Menschen.
Gary Steiner beschrieb diese Vorgehensweise am Beispiel der Behandlung der indigenen Völker durch die Kolonisatoren, oder der Sklaven durch die Sklavenhalter, die Familien der Sklaven durch Verkauf auseinander rissen, sie bedenkenlos Hunger, Krankheit, Schlägen oder psychischen Qualen aussetzten und sich selbst dennoch als human ansahen: Es war nicht so, dass man nicht wusste, dass diese Menschen litten. Es gab nur einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass ihre Leiden nicht zählten.
Diesen Konsens zu brechen, ist im Fall der indigenen Völker und der Sklaven den Unterdrückten selbst gelungen, die die Sprachen ihrer Unterdrücker lernten und sich schließlich in diesen Sprachen Gehör verschafften, um Teil unserer, der exklusiv menschlichen Gesellschaft zu werden. Ob es eines Tages auch nichtmenschlichen Tieren gelingt, diese Exklusivität aufzubrechen, bleibt abzuwarten; gewiss ist es nicht.
4. Live and let die: Ist eine vegane Multispezies-Gesellschaft möglich oder auch nur denkbar?
Um die enge Gefühlsbindung zwischen sich selbst und Kuksi zu verdeutlichen, und zugleich als Illustration seiner Vision einer friedvollen und egalitären Multispezies-Gesellschaft, berichtet Martin, wie Kuksi es, beeinflusst durch Martins Entsetzen bei seinen ersten Jagdversuchen, inzwischen vollkommen aufgegeben hat, andere Tiere zu jagen, und allenfalls Konkurrenten gegenüber sein Revier verteidigt, ansonsten aber menschlichen wie nichtmenschlichen Tieren mit freundlicher Neugier begegnet. Hundekenner mögen einwenden, dass es dazu eines besonders sensiblen Hundes bedarf, der vielleicht ohnehin mit keinem besonders ausgeprägten Jagdtrieb ausgestattet war, und dass es vielleicht Hunde gäbe, die niemals ihre Jagdversuche einstellten; das sei dahingestellt – nachdem Konsens darüber herrschen sollte, dass Hunde ebenso wie wir unterschiedliche Charaktereigenschaften haben, und unterschiedlich stark auf äußere Beeinflussungen reagieren. Es gibt auch zahlreiche Berichte nicht nur von Inter-Spezies-Freundschaften zwischen Tieren, die ihrer Art nach eigentlich Feinde, Konkurrenten oder Jäger und Gejagte sind, und sogar Berichte, die zu zeigen scheinen, dass auch Raubtiere nur dann jagen, wenn sie hungrig sind, und in der Lage sind, Beutetieren freundlich zu begegnen, wenn die Notwendigkeit zur Jagd gerade nicht besteht. Dies alles vorausgeschickt.
Dennoch halte ich Martin Balluchs Vision einer friedvollen, veganen Multispezies-Gesellschaft nicht nur für unrealistisch, sondern auch für einen Denkfehler. Zunächst zur realen Umsetzbarkeit: Kuksi ernährt sich von pflanzlicher Nahrung, oder von Aas, das er selbst findet. Massentauglich ist das kaum (wenn alle Wiener Hunde demnächst mit ihren Menschen in die österreichischen Berge gingen, wäre es dort vermutlich bald recht voll). Und es gibt auch Tierarten, für die anders als für Hunde oder für uns eine vegane Ernährung nicht möglich sein wird.
Problematischer jedoch finde ich die theoretische Ebene. Denn die Utopie einer veganen Multispezies-Gesellschaft, die ziemlich genau dem im Propheten Jesaja beschriebenen paradiesischen Tierfrieden entspricht, legt an die Tiere allzu menschliche Maßstäbe an, und ist in dieser Ausführung letzten Endes purer Anthropozentrismus. Konkret: Kuksi jagt nicht mehr, weil er gemerkt hat, dass Martin es entsetzlich und erschreckend findet, wenn er ein anderes Lebewesen tötet. Martin zu Liebe, und weil er es zu seinem Überleben nicht nötig hat, hat er seine Jagdversuche darum eingestellt. Er hat, aus Sympathie für seinen menschlichen Lebenspartner und um Konflikte zu vermeiden, sich dessen Maßstäben angepasst.
5. … und die Moral von der Geschicht‘ – aber welche Moral?
Mit anderen Tieren gelingt die Veganisierung nicht so leicht. Der englische Theologe David C. Clough beschreibt, wie er eine Katze beobachtet und ihr dabei die Verlockung ansieht, Jagd auf den Vogel jenseits der Fensterscheibe zu machen. Er bedauert ihre Lust, den schönen Vogel zu töten, und hofft darauf, dass in einer vollkommenen, jenseitigen Welt die Lust, zu jagen und zu töten, bei niemand mehr existieren wird, auch nicht bei der Katze. Hier treffen sich der Atheist Balluch und der Theologe Clough – und sitzen beide in derselben anthropozentrischen Falle. Denn schließlich: woher sollten wir – Martin, David Clough, ich oder wer auch immer -, das Recht haben, anderen Spezies zu erklären, was Moral, was Recht und Unrecht ist?
Es gibt tatsächlich Vogelfreunde, die sich über die böse Katze aufregen, die gerade den schönen unschuldigen Vögel tötet, und dabei gedankenlos in ein Schinkenbrot beißen – in das Fleisch eines ebenso süßen und unschuldigen Kälbchens oder Schweinchens. Und das, obwohl sie wesentlich freier sind in unseren Entscheidungen als die Katze, und sich auch ohne das Fleisch anderer bestens ernähren könnten. Für die Katze aber gelten andere Maßstäbe. Und wir müssen ehrlich sagen: wir kennen sie nicht. Und wir können darum auch uns kein Urteil darüber erlauben, ob diese besser oder schlechter sind als unsere. Mit Sicherheit sind sie nur eins: anders. Aber darum keinen Deut weniger zu achten als unsere.
Wenn Kuksi sich aus Liebe und dank der großen Anpassungsfähigkeit, über die intelligente Hunde verfügen, Martins Maßstäbe zu eigen gemacht hat, macht das einem Hund wie ihm das egalitäre Zusammenleben mit einem Menschen als Teil der menschlichen Gesellschaft zwar möglich. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass das für andere Individuen und Arten möglich oder auch nur wünschbar ist. Denn darin besteht doch eigentlich die vollkommenste Autonomie: sich selbst zu sein.
6. Lesen? Lesen!
Dank der schönen und sehr persönlichen Erlebnisse, die Martin aus seiner gemeinsamen Zeit mit Kuksi berichtet, gerade vor dem Hintergrund der faktisch weitgehend rechtlosen Stellung nichtmenschlicher Tiere, könnte ich mir vorstellen, dass manche/r LeserIn, der vorher gedankenlos seine Katze streichelnd ins Schinkenbrot biss, ins Nachdenken kommen könnte. Vielleicht auch manche/r HundebesitzerIn, der oder die nach der Beschreibung Kuksis dem eigenen Lebensgefährten ein wenig mehr Autonomie zugestehen könnte – auch wenn es in beiden Punkten ganz sicher unverbesserliche Härtefälle unter unseren ArtgenossInnen gibt, was menschliches Dominieren in der Hundeerziehung, oder in Tier-Mensch-Beziehungen überhaupt angeht. Für alle anderen ist es jedenfalls ein nettes Buch, flüssig geschrieben, mit einer Fülle von Informationen und Anstößen zum Weiterdenken.
7. Oder selbst erleben! Bei uns:
Wer Martin und Kuksi kennenlernen will, sei herzlich eingeladen zur Buchvorstellung und Diskussion, zuerst Freitag, 13.3.2015, 19:00 Uhr im Mehringhof, Gneisenaustr. 2a in Berlin, gemeinsam mit der Philosophin Friederike Schmitz, danach Samstag, 14.3.2015, 18:00 Uhr in der Stadtbibliothek Eberswalde.